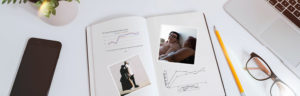Neueste Forschungsergebnisse zeigen: Romantische Beziehungen spielen für heterosexuelle Männer eine größere Rolle – mit überraschenden psychologischen Hintergründen. Was können wir daraus für den Beziehungsalltag und mögliche Beratungsansätze ableiten?
Liebe als Lebensanker?
Wer denkt, dass Frauen stärker auf romantische Beziehungen angewiesen seien als Männer, irrt. Lange Zeit galt das gängige Klischee, dass Frauen emotionaler seien, mehr über Liebe sprechen und romantische Bindungen stärker bewerten. Eine Meta-Analyse von Iris Wahring und Kollegen zeigt nun: Männer messen romantischen Partnerschaften mehr Bedeutung bei als Frauen – in Bezug auf Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit und soziale Stabilität.
Das Ergebnis wirkt auf den ersten Blick kontraintuitiv und stellt Genderstereotype auf den Kopf. Doch je tiefer man in die psychologischen Mechanismen eintaucht, desto deutlicher zeigt sich: Es ist weniger ein Widerspruch als vielmehr ein Perspektivwechsel nötig.
Was das Studienergebnis zeigt
Aus zahlreichen Studien wissen wir, dass Frauen typischerweise mehr emotionale Unterstützung von ihrem sozialen Umfeld erhalten als Männer. Daher sind heterosexuelle Männer stärker von ihrer festen Partnerin abhängig, um ihre emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen als heterosexuelle Frauen. Kurz gesagt, feste Beziehungen sind psychologisch wichtiger für Männer als für Frauen.
So fasst es die Autorin der Studie zusammen. In der Auswertung von über 50 Forschungsarbeiten zeigte sich zudem, dass Männer in festen Beziehungen seltener als Frauen den ersten Schritt zur Trennung machen, sich nach Trennungen eher einsam fühlen und die positiven Aspekte eines Beziehungsendes weniger oft erkennen.
Das gesellschaftliche Verständnis von typisch weiblich und typisch männlich wird in der Meta-Analyse ebenso auf die Probe gestellt. Beziehungen spielen eine besonders wichtige Rolle, wenn es um die Gesundheit von Menschen geht. Für Mädchen sei es üblich und viel angemessener als für Jungen, Emotionen und Verletzlichkeiten zu teilen, sagen die Autor*innen.
Emotionale Kompetenz: Ein unterschätztes Puzzlestück
Ein zentraler Aspekt in der Interpretation dieser Geschlechterunterschiede liegt in der sogenannten emotionalen Kompetenz. Diese wird als Konstrukt verstanden, Emotionen wahrzunehmen, zu nutzen, zu verstehen, zu steuern und mit ihnen umzugehen. Studien zeigen, dass Frauen im Durchschnitt feinfühliger im Wahrnehmen und Verarbeiten eigener und fremder Emotionen sind. Sie pflegen oft intensivere soziale Netzwerke, in denen emotionale Themen ausgetauscht und reguliert werden – nicht nur in romantischen Beziehungen, sondern auch mit Freund*innen, Familienmitgliedern oder im Kolleg*innenkreis.
Männer hingegen neigen in vielen westlichen Kulturen dazu, emotionale Intimität fast ausschließlich in der Partnerschaft zu suchen und zu finden. Die romantische Beziehung wird somit zur emotionalen Hauptversorgung – eine Art Ein-Personen-System für Nähe, Trost und Verständnis. Diese „Einseitigkeit“ erklärt, warum Männer bei Trennungen oft stärker unter Einsamkeit und emotionalem Entzug leiden. Ihnen fehlt schlichtweg der Zugang zu weiteren emotionalen Ressourcen.
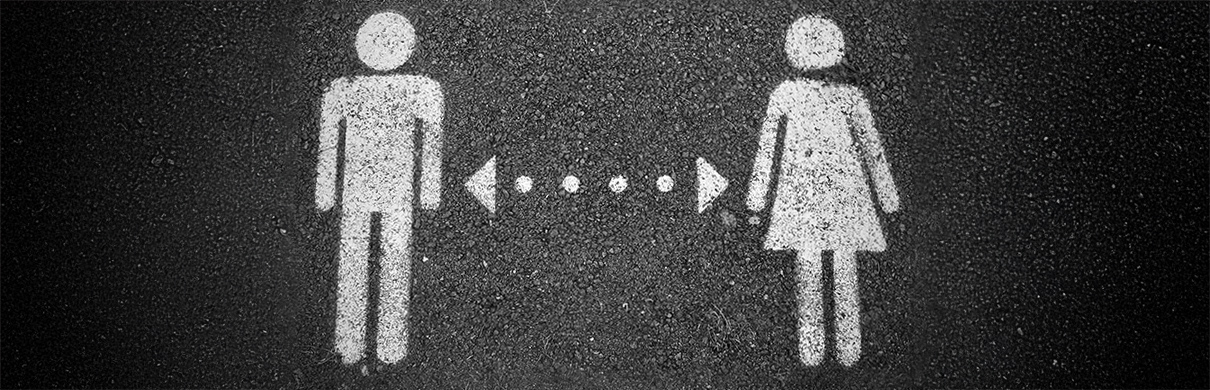
Emotionale Abhängigkeit oder einfach eine andere Sozialisation?
Das Team um Umberson kam bereits 1996 zu folgender Erkenntnis: Starke soziale Beziehungen fördern grundsätzlich das psychische Wohlbefinden. Wer viele und qualitativ hochwertige, unterstützende Beziehungen hat, ist generell glücklicher, leidet weniger unter Stress oder Angst und lebt gesünder. In dieser Studie wurde deutlich, dass Frauen im Vergleich zu Männern tendenziell über eine „soziale Mehrgleisigkeit“ verfügen – ihre emotionale Welt ist breiter aufgestellt. Männer hingegen knüpfen meist weniger, aber dafür oft funktionsbezogenere Kontakte.
Diese Unterschiede sind jedoch nicht biologisch festgeschrieben. Vielmehr spiegeln sie jahrzehntelange Sozialisationsmuster wider: Jungen lernen oft, Gefühle zurückzuhalten, sich nicht verletzlich zu zeigen und emotionale Abhängigkeit als Schwäche zu sehen. Gleichzeitig wird romantische Liebe in der Popkultur für Männer häufig als der einzige legitime Ort emotionaler Öffnung dargestellt. Frauen hingegen werden ermutigt, Beziehungen vielfältiger zu gestalten und emotionale Nähe auch in nicht-romantischen Kontexten zuzulassen.
Was heißt das für die Liebe heute?
Die Vorstellung, dass Männer emotional „abgehärteter“ seien, verkehrt sich mit dieser neuen Forschung fast ins Gegenteil. Nicht weil sie schwächer wären – sondern weil ihnen die Werkzeuge fehlen, emotionale Bedürfnisse jenseits der romantischen Liebe zu regulieren. Das kann nicht nur Beziehungen belasten, sondern auch die eigene psychische Gesundheit. Von der Partnerin abhängig zu sein, klingt für die meisten vermutlich nicht besonders erstrebenswert.
Gleichzeitig bieten sich auch Chancen: Je mehr Männer ermutigt werden, emotionale Kompetenz zu entwickeln, über Gefühle zu sprechen und Freundschaften tiefer zu gestalten, desto weniger entsteht emotionale Abhängigkeit von einer einzigen Beziehung. Für Frauen kann es ebenso entlastend sein, wenn sie nicht länger allein die emotionale Hauptverantwortung im Beziehungssystem übernehmen müssen.

Was wir daraus lernen können
Wichtig: Die Ergebnisse der Metaanalyse zeigen Tendenzen, keine absoluten Wahrheiten. Personen, die sich als LGBTQ+ bezeichnen, wurden in der Studie nicht explizit berücksichtigt. Natürlich gibt es auch Männer, die emotional kompetent, reflektiert und beziehungsfähig sind – genauso wie auch Frauen, die mit Emotionen hadern. Doch gerade auf gesellschaftlicher Ebene wird deutlich: Wir haben bislang keine Strukturen geschaffen, die Männer wirklich dazu befähigen, Emotionalität zu entwickeln, zu zeigen und als Ressource zu begreifen.
Das ist kein individuelles Versagen, sondern ein kollektives. Wenn heterosexuelle Männer stärker auf romantische Beziehungen angewiesen sind, aber seltener lernen, ihre Gefühle auszudrücken, Nähe aktiv zu gestalten oder Verletzlichkeit zuzulassen, kann ein Ungleichgewicht in Beziehungen entstehen.
Für die Beratung und Therapie bedeutet das, Kompetenz zu vermitteln. Die Aufgabe der Gesellschaft besteht darin, durch Bildung und öffentliche Vorbilder neue Räume für Verbindung und Verständnis zu schaffen. Männer brauchen keine Erlaubnis, vielfältige Gefühle zu haben. Sie brauchen eine Gesellschaft, die sie dabei ernst nimmt, unterstützt und emotionales Wachstum genauso wertschätzt wie andere Formen von Stärke.
Quellen:
- Romantic Relationships Matter More to Men than to Women (2024)
- Emotional Intelligence – What Do We Know? (2012)
- Models of Emotional Intelligence (2005)
- Women, men, and positive emotions: A social role interpretation (2000)
- Are Men and Women Really So Different? (1996)
- Fotos: Pea (Unsplash), Emmanuel Ikwuegbu (Unsplash)